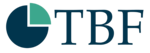TBF Artikel vom 09.07.2025
Am 28. April erlebte die iberische Halbinsel einen massiven Stromausfall: Spanien, Portugal und Teile Frankreichs waren plötzlich ohne Energie. Der Alltag stand still – kein Internet, kein Mobilfunk, nur alte Festnetztelefone oder Transistorradios funktionierten noch. Was zunächst wie ein Szenario aus der Vergangenheit wirkte, war in Wahrheit ein Warnsignal für die Zukunft Europas.
Nach ersten Aufregungen und Spekulationen wurde schnell klar: Weder ein Cyberangriff noch erneuerbare Energien per se waren verantwortlich. Die Ursache lag tiefer – in der Struktur des Stromnetzes selbst. Technisch gesprochen kam es zu sogenannten Netzpendelungen. Diese entstehen, wenn die Stromerzeugenden Generatoren nicht mehr synchron arbeiten oder einfach nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden sind. Fehlt dieses stabilisierende Element im Netz, kommt es zu Kettenreaktionen: Ein Generator fällt aus, andere folgen, und schließlich bricht die Spannung komplett zusammen. Windenergie und Solarparks haben keine mechanische Trägheit, wie sie klassische Kraftwerke bieten. Fällt ein Park aus, ist die Leistung sofort weg – es gibt kein „Nachlaufen“. Um derartige Stromausfälle zu vermeiden, braucht es moderne Technik: Batterien, Speicher, schnelle Regelmechanismen und eine clevere Sensorik, die Unregelmäßigkeiten früh erkennt und ausgleicht. Vor allem aber eine Einbindung in ein europäisches Verbundnetz, so dass fehlende Kapazitäten aus Nachbarländern eingekauft werden können. Nur etwa drei Prozent des spanischen Netzes sind mit europäischen Partnern wie Frankreich verbunden – deutlich unter dem angestrebten EU-Ziel von 15 Prozent.
Somit war ein entscheidender Faktor beim Stromausfall auf der iberischen Halbinsel die geringe Verbindung zu Kontinentaleuropa. Wenn diese „Strombrücken“ fehlen, wird ein nationales Problem schnell zum regionalen Desaster.
Was bedeutet das für einen Energieinfrastrukturfonds wie den TBF SMART POWER? Europas Netze müssen fit gemacht werden für die Zukunft. Nicht nur durch neue Leitungen, sondern durch einen intelligenten Mix aus Infrastruktur, Speicherlösungen und grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Dabei ist klar: Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt, Investitionen gefördert und die Energieversorgung als Gesamtsystem verstanden werden. Dies gilt auch für uns in Deutschland. Auch hier ist die Lage nicht sicherer. Ein plötzlicher Ausfall großer Strommengen – etwa durch Wind- oder Solarstrom – stellt auch das deutsche Netz vor Herausforderungen. Noch gibt es zu wenig Batteriekapazität, um solche Schocks abzufedern.
In Spanien hat man reagiert und Investitionen in Aussicht gestellt, die bei den Unternehmen in unserem Fonds ankommen dürften. Am Ende bleibt dieser Blackout ein Weckruf: Die Energiewende ist mehr als der Wechsel von fossilen zu erneuerbaren Quellen – sie erfordert eine grundlegende Modernisierung der Infrastruktur. Damit Europa auch in Zukunft hell bleibt.